Wie jedes Jahr trafen sich zur Großen Woche die schönsten Huren Europas, die reichen südamerikanischen Drogenbosse, Banker, Industrielle und Politiker, um Geschäfte zu machen. Rodrigo, schlank, mittelgroß, mit schwarzem, im Nacken zusammengebundenem Haar, war mit seiner Privatmaschine über London, Prag und Zürich nach Baden-Baden gekommen, hatte Antigua und Helen an der Côte aufspüren lassen, wo sie den Sommer über arbeiteten, und in die Stadt bestellt.
Während sich in den Suiten der Luxushotels die Zimmermädchen am Morgen normalerweise durch Schwaden des süßlich-brennenden Haschischgeruchs zu den Fenstern kämpfen mussten, um die Räume zu lüften, und in der Rennwoche die verschärfte Anweisung galt, den feinen Kokainstaub spurenlos von den Glastischen zu wischen, übten sich gerade die Südamerikaner in Puritanismus, was Rauschgifte anging, und achteten peinlich darauf, kein Zehntelgramm bei sich zu tragen. Von ihren Leibwächtern wurde
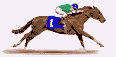
erwartet, dass sie die handlichen Schnellfeuerpistolen, die sie mit sich führten, für die Dauer des Aufenthaltes in den Safes der Hotels deponierten, wo sich zeitweise die Waffen so häuften, dass Verwechslungen vorkamen. Mit den ungeduldigen Herren ergaben sich schwierige Situationen, und eine Art Garderobenmarke musste eingeführt werden.
Rodrigo kümmerte sich nicht um solche Dinge. Er war gekommen, um Geschäfte zu machen, bei denen er sein Geld in Europa anlegen konnte. Drogen und Waffen durften nicht in seine Nähe.
Im Grunde, pflegte er im hart klingenden kolumbianischen Spanisch zu sagen, bin ich nicht hier!
Und obwohl er über zehn Jahre lang zweimal jährlich in die Stadt kam, das beste Hotel bewohnte und am gesellschaftlichen Leben teilnahm, um seine Geschäfte abwickeln zu können, gab es nach all dieser Zeit niemanden, der bezeugen wollte, ihn gekannt zu haben.
Als er Therese kennen lernte und die Distanz zu seinem Beruf größer wurde, begegnete ihm in den Thermen einmal ein Mann, der ihm als Etagenkellner bekannt war. Er nickte ihm zu, aber der Mann erwiderte den Gruß nicht, obwohl er Rodrigo gesehen haben musste, und Rodrigo dachte, voller Bewunderung für die Perfektion der in der Stadt gebotenen Dienstleistungen: Man weiß, dass ich nicht hier bin, und jeder hält sich daran!
Stets begleiteten ihn einige Männer seiner Leibwache. Und doch vergewisserte er sich dadurch nur seiner Position. Denn sie garantierten ihm etwas sehr Seltenes: äußere Distanz. Seinen Schutz übernahm ein privates deutsches Wachunternehmen, spezialisiert auf Fälle dieser Art. Deren Männer durften Waffen tragen und arbeiteten mit der örtlichen Polizei zusammen.
Rodrigo war jetzt 42 und hatte das Unternehmen von seinem älteren Bruder übernommen, der in den USA für hundertzwanzig Jahre hinter Gittern saß. Ihr Vater hatte das Geschäft aufgebaut, aber erst sein Bruder hatte es groß gemacht gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Land und die international so erfolgreichen Chinesen. Er hatte die katalanische Küste und den spanischen Markt als Sprungbrett für Europa erschlossen, und Rodrigo sah sich nun in einer Generationenabfolge, wo die Gelder wie von alleine flossen und das Unternehmen zu verzweigt war, um einfach zerschlagen zu werden: zu viele Arbeitsplätze hingen davon ab, der kolumbianische Staat würde helfend eingreifen. Die eigentliche Aufgabe für Rodrigo bestand darin, die Gewinne sicher, das hieß: außerhalb des Drogenbereichs, anzulegen.
Manchmal stritt er mit seinem Neffen über seine Arbeit. Alfonso durchlief gerade seine Lehrjahre, arbeitete als Straßendealer, Verteiler und in den Labors und führte unter dem Schutz der Sonderbewachung, auf die er Anspruch hatte, auch wenn er niedrige Arbeiten versah, zwei Mordanschläge durch, auf kurze Distanz, wie er es gewünscht hatte: für den Richter das Messer, für eine Journalistin, nachdem er sie vergewaltigt hatte, die Drahtschlinge.
Alfonso, trotz des modischen Gehabes seiner Jugend nicht cool, sondern stets ein wenig zu nervös, warf seinem Onkel vor, satt und faul geworden zu sein.
Langsam, rief er hitzig, erinnerst du mich an diese fetten Schweine vom Unternehmerverband!
Er schaute ihn herausfordernd an.
Du redest, antwortete Rodrigo ruhig, wie eins von diesen fetten Schweinen von den Gewerkschaften! Willst du vielleicht eine Abreibung, Alfonso? Das kühlt!
Sie rangen miteinander. Der Staub der Reitbahn wirbelte hoch in die Luft und hüllte zuerst ihr Keuchen, dann ihr Lachen ein, als der Ältere den jüngeren unter sich zwang.
Gibst du auf?
Natürlich! Du brichst mir den Arm!
Der Onkel ließ ihn frei, und sie klopften den Staub von ihren Kleidern.
Bald bin ich soweit! sagte Alfonso zufrieden.
Ja, sagte Rodrigo, ohne eine Spur von Hast in seiner Stimme: wenn ich es dir sage!
In Baden-Baden begleiteten ihn Antigua und Helen. Sie traten auf wie Privatsekretärinnen, selbstsicher und distinguiert, dabei ungewöhnlich schön, mit guten Umgangsformen und einer profunden Allgemeinbildung, sodass in Gesellschaft nie jene peinliche Situation entstand, dass man von ihrem Benehmen, ihrer Art sich zu kleiden oder aus dem, was sie sagten, schließen konnte, was sie waren.
Eher kam es vor, dass gutbürgerliche Frauen in der Großen Woche, wenn jeder wusste, dass viele Huren in der Stadt waren, nach ihrem Preis gefragt wurden.
Als sich durch Therese Rodrigos Beziehung zu den beiden veränderte, da er nun mehr ihren Rat als ihren Körper wünschte, fragte er aus einer unbedachten Laune heraus, was eigentlich wirklich von ihnen präsent sei in Baden-Baden.
Antigua antwortete: Das geht Sie nichts an, Senor Abalás! Dann aber verzog sie den Mund noch zu einem Lächeln: Mehr als mein Arsch jedenfalls nicht!
Und Helen, eigentlich die sanftere von beiden, antwortete ebenso ohne zu zögern: Mein Vater nicht, mein Kind nicht, mein Zuhälter auch nicht! - Antigua hat Recht, Senor Abalás: Es geht Sie nichts an!
Jeden Morgen um sechs verließ Rodrigo sein Hotel durch die Gartenpforte, erreichte das andere Ufer der Oos über eine kleine Brücke, die nur Hotelgästen offenstand, und lief die Lichtentaler Allee flussaufwärts - nicht so sehr wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie eben war und fast frei von Durchgangsverkehr. Helen und Antigua begleiteten ihn.
Am Ende dieses langgestreckten englischen Gartens lag das Kloster Lichtental, eine alte Zisterzienserinnen-Abtei. Dort wartete ein Wagen auf sie. Manchmal liefen sie zeitig genug, um an der Frühmesse teilzunehmen. Dann frühstückten sie mit den freundlichen Nonnen, und Rodrigo tauschte mit der ehrwürdigen Äbtissin die Wonnen des Schweigens.
Im Lauf des Vormittags besuchten sie die städtische Trinkhalle. Baden-Baden warb vor allem in den Ländern des Machismo mit der potenzsteigernden Wirkung der Friedrichsquelle, und Rodrigo hatte schon in Medellín von ihrer Kraft gehört. Zwar schien es ihm nicht falsch, in dieser Hinsicht vorsichtig zu sein, aber die zweite Indikation war ihm wichtiger: Ein alter Mann hatte ihm erzählt, die Quelle verlängere das Leben. Mit jedem Glas gewinne er einen Tag.
Rodrigo glaubte an solche Vorhersagen und nahm stets einen Vorrat des Wassers mit nach Kolumbien. Im Lauf der Jahre hatte er nicht wenige Menschen sterben sehen, darunter seinen Vater und seine erste Frau. Es war um die Herrschaft über die karibischen Verkehrswege gegangen, und er hatte diese Frau geheiratet, um einen Krieg zwischen seiner Familie und der Familie dieser Frau noch hinauszuzögern.
In Baden-Baden trank er jeden Tag von der Quelle, obgleich sie ihn wegen ihrer Wärme und ihres Geschmacks an dampfende Pferdepisse erinnerte: an seine kleinen, eisenharten Polopferde, wenn sie sich nach ihrem Einsatz, zitternd vor Anstrengung und Vorfreude, endlich erleichtern durften.
Zu dem Zeitpunkt, als die Erzählung einsetzt, hatte er auf diese Weise einen sicheren Vorrat von nicht weniger als neunhundertsiebenunddreißig Tagen.
Manchmal sinnierte er kopfschüttelnd über diese Art Leben. Dann lachte er breit über das schon etwas aufgedunsene Gesicht und spürte zugleich den bitteren Eisenkern der Melancholie auf der Zunge.
Was für eine grandiose Vergeblichkeit! sagte er zu sich. Wahrscheinlich verdanke ich mein Leben einmal der dampfenden Pisse von Pferden!
Rodrigo aß nur wenig zu Mittag. Die opulente französische oder italienische Küche der meisten Hotels behagte ihm nicht. Steaks, Salat, Wasser statt Wein. Dann zog er sich mit Helen und Antigua auf seine Suite zurück. Am Nachmittag besuchten sie die Rennen in Iffezheim. Er wettete große Summen und gewann nicht selten, denn er hatte ein Auge für Pferde, beteiligte sich im Grunde aber nur wegen der beiden Frauen am Spiel - glaubte er doch, diese würden hier einmal vergessen, dass er sie bezahlte, und so schätzte er, was er für ihre naive Begeisterung hielt, fast mehr als ihre eigentlichen Dienste. Ansonsten interessierte ihn das Wetten nicht besonders, und Pferderennen langweilten ihn, schon weil er es gewohnt war, seine eigenen Herden frei über die Weideflächen seiner Haziendas laufen zu sehen.
Irgendwann, wenn die Pferde ihre Runden drehten, nahm Rodrigo die anderen Zuschauer auf der Ehrentribüne zur Kenntnis: die bekannten Gesichter aus dem internationalen Drogengeschäft, die führenden Bankiers, die in der Großen Woche aus allen Teilen Europas nach Baden-Baden kamen, wie Schmeißfliegen auf einen Misthaufen, und schließlich die heimischen Politiker, die sich als Vermittler anboten und nach allen Seiten lächelten.
Nirgendwo in Europa war in der Großen Woche soviel Geld auf einem Fleck wie in dieser kleinen, überschaubaren Stadt. Seit Jahren hatten sich bestimmte Plätze herausgebildet, wo man handelseinig werden konnte, herrschte doch von Medellín und Cali bis Miami und Barcelona die Übereinkunft, dass, wer nach Baden-Baden komme, ein Angebot zu machen habe.
Um das Geschäft einzufädeln, lautete die Frage: Kennen Sie Monsieur Bénazet?
Und die Antwort musste sein: Nein, aber ich werde sie morgen kennen lernen!
Denn es handelte sich bei den Bénazets um Brüder - beide im übrigen seit hundert Jahren tot.
Sie waren es gewesen, die mit Rennbahn, Casino und Theater den europäischen Adel von Paris, wo er vertrieben worden war, zumindest zeitweise nach Baden-Baden lockten, indem sie nicht nur Geschäfte anboten und Restauration, sondern auch die Möglichkeit, sich zu zerstreuen. Man sah sich beim Rennen, auf dem Laufsteg der Lichtentaler Allee, in den Salons der großen Welt oder des Nachts in der Spielbank, nahm sich zur Kenntnis und unterbreitete ein Angebot.
Früher waren vor allem Kriege ausgehandelt worden. Bei den Waffengeschäften traten Rumänen und Tschechen als Produzenten auf, afrikanische und südostasiatische Länder führten die endlos gewundene Schlange der Verbraucher an. Als Vermittler agierten Franzosen und hielten die Waffensysteme in elsässischen Scheunen zur Ansicht.
Aufgrund der Analyse einer Unternehmensberatung spezialisierte sich die Stadt jedoch seit Ende der siebziger Jahre auf Serviceleistungen, wenn es darum ging, Drogengewinne in Europa anzulegen. Der Weg erwies sich als richtig. Eine moderne Thermenlandschaft wurde gebaut, die Sanierung des historischen Viertels vorangetrieben und die Innenstadt durch einen Tunnel vom Verkehr entlastet. Das Geschäft mit den Kurgästen und der Massentourismus liefen eher nebenher, ebenso die Beherbergung von wohlhabenden Alten, die irgendwann kamen, um eine karge Wintersaison mit dem ausserordentlichen Zeugnis ihres langsamen Todes zu bereichern.
Als Rodrigo zur Zeit der Großen Woche einmal mit Therese auf der Terrasse des Parkallee-Hotels zu Abend aß - es war die letzte Rennsaison, die sie gemeinsam erleben sollten -, erlitt am Nebentisch ein älterer Mann, der von zwei Pflegerinnen in Schwesterntracht begleitet wurde, einen Schlaganfall. Er stürzte ruckartig nach vorn, und die Hummergabel, mit der er bis dahin sehr geschickt hantiert hatte, drang dem weisshaarigen, distinguiert und vornehm wirkenden Greis, es war ein französischer Graf, durchs linke Auge in den Stirnlappen des Großhirns, wo der Pathologe später ein Stück bretonischen Hummers im Gemüsesud entfernte.
Die Gäste an den anderen Tischen übergaben sich noch auf der Terrasse. Doch Therese, die drei Kinder geboren und ihren Mann hatte sterben sehen, nahm den Vorfall mit einiger Gelassenheit und versuchte den beiden jungen Pflegerinnen zu helfen. Aber es war nicht mehr viel zu tun.
Als sie gingen, streifte Rodrigo den Körper, der unter einem sauberen Tischtuch ausgestreckt lag, mit einem abschätzigen Blick.
Es ist seltsam, sagte er kühl: Aber hier sterben sie alle so oder ähnlich! Die Todessüchtigen kommen in Massen in diese Stadt, und jeder von ihnen steht plötzlich vor der Notwendigkeit, einen einzigartigen und höchst individuellen Tod zu inszenieren. Es war nicht einmal die schlechteste Art!
Um Angebote einzuholen, schickte man Emissäre. Für diesen Zweck nutzte Rodrigo seine kolumbianischen Leibwächter: Hervé war ein promovierter Jurist, Jean ein Mediziner, der sich an der Ostberliner Charité habilitiert hatte, und Fernando ein Wirtschaftsprüfer, der bei der UNESCO gearbeitet hatte. Diese Männer aßen mit Messer und Gabel, tranken Mineralwasser und diskutierten, sofern Rodrigo sie dazu einlud, mit ihm die Philosophie Heideggers, die Musik von Cage oder die Blechplastiken Chamberlains - und waren darüber hinaus jederzeit bereit, den zahlreichen Morden, die sie bereits hinter sich hatten, weitere hinzuzufügen.
Bis zu Rodrigos Tod war der traditionelle Ort für die Geschäftsabschlüsse die Gönner-Anlage, benannt nach einem früheren Oberbürgermeister der Stadt: ein Jugendstilgarten im französischen Rokokostil, mit unübersichtlichen Hecken, schwer einsehbaren Laubengängen und einer Reihe von einladenden Bänken. In der Saison wurde die Anlage von Arbeitern der Bäder- und Kurverwaltung gepflegt, jeden Morgen und noch einmal mittags, bevor die Hauptgeschäftszeit begann. Die Wege wurden geharkt und gesprengt, Papier aufgesammelt, Zigarettenkippen aus den Sträuchern entfernt, Cola-Dosen und Präservative. Eine Sondereinheit der örtlichen Polizei durchsuchte den Garten nach Sprengkörpern und Mikrofonen, zog sich sodann diskret zurück und achtete darauf, dass die Geschäfte nicht durch Liebespaare, Journalisten oder spielende Kinder gestört wurden.
Rodrigo sah dort für den Nachmittag eine Stunde vor, um seine Geschäfte abzuwickeln. Er hatte sich bei der Bäder- und Kurverwaltung von sechzehn bis siebzehn Uhr eine bestimmte Bank reservieren lassen, wo die schon abendliche Sonne sein jeweiliges Gegenüber blendete. Die Zeit war knapp. Bankiers und Großindustrielle wurden in Abständen von fünfzehn Minuten bestellt, Politiker hatten zehn Minuten und waren aufgefordert, sich daran zu halten. Nicht selten erschienen sie zu früh und standen dann in einer kleinen englischen Warteschlange, bis man sie vorließ.
Rodrigo verachtete diese Unterwürfigkeit und schätzte bei seinen Freunden einen mit Widerhaken gepaarten Geist, geeignet, über die wichtigen Dinge im Leben zu reden - vor allem aber über die Liebe.
Therese sagte einmal, als sie schon einige Nächte mit ihm verbracht hatte und ihn ein wenig besser kannte: Vielleicht ist das sein eigentliches Talent: wie er über die Liebe redet.
Denn der Südamerikaner wusste um das wechselhafte Verhältnis von Nähe und Distanz zwischen Männern und Frauen und schien, jedenfalls zu Beginn, nicht zu den Männern zu gehören, die sich in den fruchtbaren Landschaften der Einsamkeit verirrten, wie viele seiner Art. Vielmehr versuchte er sich gegen den eigenen Machismo mit Selbsterkenntnis zu wappnen: Der tückische Furunkel sollte aufbrechen, sobald Rodrigo die Distanz zu sich verlor. Doch letztlich kam, was er über sich selbst erfuhr, stets auf lächerliche Weise zu spät, um sein Leben noch zu ändern. Und nicht selten wurden Erfahrung und Erkenntnis auch bei ihm überlagert von einer kunstvoll auf seinen skeptischen Geist zugeschnittenen Form von Melancholie.
Helen und Antigua saßen neben Rodrigo auf der Bank, hörten aufmerksam zu, sagten nie ein Wort und vergaßen alles, wenn sie sich Schlag siebzehn Uhr zusammen mit Senor Abalás erhoben. So verliefen die Tage. Abends lud man befreundete Südamerikaner ein, Franzosen aus Straßburg oder Paris, nur wenige Deutsche. Zumeist trafen sich acht oder zehn Personen. Die Gespräche hatten die Entwicklungen der Zeit zum Thema, die Literatur, die Künste, weshalb nur selten Bankiers oder Politiker teilnahmen.
Rodrigo hatte an der Sorbonne Philosophie und Jura studiert und war häufig mit Intellektuellen zusammen gewesen, mit Filmemachern, Literaten, Universitätsprofessoren. Nur die wenigsten wussten, welcher Art von Geschäften der scheue Kolumbianer mit der französischen Mutter und dem indianischen Vater nachging. Wer es erfuhr, vergaß es bald wieder, oder es wurde ihm letztlich egal.
Spät am Abend besuchte Rodrigo noch das Casino, dessen lärmende Prunkhaftigkeit ihn an den archaischen Geschmack seines Vaters erinnerte. Diesem war bei einer Wette ein Haus aus der Kolonialzeit zugefallen, im unruhigen Grenzgebiet zu Ecuador, und sobald er es im Kokaingeschäft zu etwas gebracht hatte, stattete er das schlossartige Anwesen mit allen barocken Kostbarkeiten aus, die er in europäischen Herrenhäusern und Adelssitzen auftreiben konnte.
Rodrigos Mutter sagte zwar: Schweine grunzen auch, wenn man sie auf Daunen bettet!
Aber sein Vater kannte sich aus mit den gelehrigen Tieren und grinste nur zufrieden.
Er hatte diese Frau auf der Avenue de l'Opéra in Paris gesehen und durch einen großzügigen Vertrag an sich gebunden: bis zwei Söhne geboren, erzogen und herangewachsen waren. Und Rodrigo, sein zweiter Sohn, ging nun jeden Abend ins Casino von Baden-Baden, um zwanzig- oder dreißigtausend Mark zu verspielen - als eine Art Ausgleich (man vermied das Wort Bezahlung) für den Service, den die Bäder- und Kurverwaltung bei der Abwicklung der Finanzgeschäfte bot.
Am Nachmittag jenes Tages, an dem Rodrigo Abalás noch einen Vorrat von neunhundertsiebenunddreißig Tagen hatte, lief gegen sechzehn Uhr dreißig eine Fünfjährige durch die Gönneranlage und hielt geradewegs auf die Bank zu, die er gemietet hatte. Ein Windstoß bauschte Haar und Kleidchen des Kindes und machte sie für den Augenblick durchlässig für einige Sonnenstrahlen. Es sah sehr hübsch aus.
Rodrigo verhandelte gerade mit einem hanseatischen Bankvorstand, der anbot, eine Summe von fünf bis sieben Millionen Dollar mit Achteinviertel auf drei Jahre zu verzinsen und nach Ablauf der Frist, das war das eigentlich Interessante, Kapital und Zinsen sicher nach Zürich zu transferieren.
Zwanzig Schritte vor der Bank stürzte ein Polizist in Zivil hinter einem der Rosenbüsche hervor, packte das Kind, hob es spielerisch in die Luft und setzte es mit den Worten: Geh schön spielen, aber nicht hier! wieder auf den Boden, damit es in die Richtung zurückliefe, aus der es gekommen war.
Der Polizist, ein junger Mann mit einem freundlichen Gesicht, beugte sich noch einmal über die Schulter des Mädchens und flüsterte ihm etwas zu. Dann schob er es vorwärts. Doch das Kind ließ sich fallen und begann laut zu schreien. Der Polizist wollte es aufheben und wegtragen, aber es strampelte wild mit den Beinen, trat um sich und schrie noch mehr.
Durch die torbogenartige Öffnung der Hecke erschien nun eine Frau, die einen Kinderwagen schob und ein weiteres Kind auf dem Arm trug. Auf den ersten Blick mochte sie dadurch schwerfällig wirken. Doch als sie ihre Älteste auf dem Boden sah, über ihr den fremden Mann, ließ sie ohne Zögern den Kinderwagen stehen und fiel, mit dem Kind auf dem Arm, ganz wie man es sich von heroischen Darstellungen der Malerei, des Films und der Literatur denken kann, über den Mann her, stieß ihn beiseite, sodass er rückwärts in die Dornen stolperte, und hob die Kleine vom Boden auf. Jetzt hatte sie beide Arme voll, und von den umliegenden Bergen stürzten sich die Indianer auf die Postkutsche.
Therese war Mitte dreißig, hatte drei Kinder und einen Mann, der vor einem Jahr bei der Geburt des jüngsten Kindes gestorben war. Seither bekämpfte sie das Leben allein, glaubte auch schon, es so langsam gelernt zu haben: und nun das!
Sie war weder hässlich noch besonders schön, doch der Wunsch, wieder geliebt zu werden, ließ sich seit geraumer Zeit nicht mehr verbergen. Ganz rücksichtslos hatte er sich nach außen gekehrt und teilte sich nun mit durch die schmerzhafte Intensität, mit der sie die Lebendigkeit ihrer Bewegungen zu unterdrücken versuchte. Aber der Wunsch legte sich auch über ihr Gesicht: als eine auf anrührende Weise aufreibende, weil allgegenwärtige Sinnlichkeit.
Danach befragt, würde sie, schon etwas resigniert, antworten, dass die Liebe nicht das ist, was man sucht, sondern das, was man findet!
Und obwohl Therese dergleichen nie für möglich gehalten hatte, rief sie nun, von fünf kräftigen, ihr unbekannten Männern bedrängt, laut um Hilfe.
Don Rodrigo Abalás jedoch erinnerte sich, als Thereses Blicke sich für einen kurzen, zufälligen Augenblick mit seinen trafen, an das, was seine Mutter am Abend des Tages sagte, an dem er seine zukünftige Frau ins Haus seiner EItern eingeführt hatte. Er sollte sie heiraten, weil ihre Familie einen beachtlichen Teil des karibischen Drogenhandels kontrollierte. Das Ganze war eine Idee seines Vaters gewesen, und nun ging es nur noch darum, die Form zu wahren.
Doch war seine Mutter an jenem Abend in sein Zimmer gekommen und hatte sich auf sein Bett gesetzt, wie früher, als sie ihn noch gegen die bösen Geister beschützte, die nachts aus dem Urwald kamen.
Was willst du mit ihr? hatte sie traurig und ohne Rücksicht auf seinen Vater gefragt: Sie hat keine Sehnsucht!
Aber diese Frau, dachte Rodrigo, hat eine Sehnsucht! Auch seine Mutter hätte das zugeben müssen!
Er bediente sich nicht seiner Leibwächter, sondern sprang selbst auf, riss den Polizisten, der Therese gepackt hatte, zurück und zischte im glühenden Spanisch der Pferdejungen, er werde ihn töten, wenn er sie noch einmal berühre.
Doch da war schon ein Polizeioffizier zur Stelle, der die heikle Situation erkannte: ein Wink, und die Männer verschwanden.
Rodrigo sprach kaum Deutsch. Wo nötig, übersetzten Helen und Antigua für ihn. Nun machte er die Erfahrung, dass es Situationen gab, wo er etwas sagen, aber nicht übersetzt werden wollte.
Er stellte sich dieser Frau förmlich und unter Hinzufügung sämtlicher Geburtsnamen vor. Da die Kinder immer noch weinten und Therese immer noch zitterte, bat er sie, sie möge sich setzen. Dann verscheuchte er mit einem Wink die Leibwächter, die ihrerseits die noch wartenden Bankiers vertrieben.
Therese war verwirrt und fühlte keine Kraft mehr in den Beinen. Deshalb kam sie der Bitte nach. Zu ihrer Überraschung entspannte sich jedoch die Situation nun rasch. Tania, das Baby, schlief wieder ein, und den beiden Älteren zeigte Rodrigo, wie man Kieselsteine und Rosenblätter in den benachbarten Josefinen-Brunnen warf.
Therese sah ihnen eine Welle aufmerksam zu. Irgendwann lehnte sie sich zurück, breitete die Arme aus und wagte es, ab und zu die Augen zu schließen: nur kurz, weil sie wusste, dass alles ein Traum war (...)
_______________________________
siehe auch:
Bald reit' ich davon
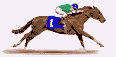 erwartet, dass sie die handlichen Schnellfeuerpistolen, die sie mit sich führten, für die Dauer des Aufenthaltes in den Safes der Hotels deponierten, wo sich zeitweise die Waffen so häuften, dass Verwechslungen vorkamen. Mit den ungeduldigen Herren ergaben sich schwierige Situationen, und eine Art Garderobenmarke musste eingeführt werden.
erwartet, dass sie die handlichen Schnellfeuerpistolen, die sie mit sich führten, für die Dauer des Aufenthaltes in den Safes der Hotels deponierten, wo sich zeitweise die Waffen so häuften, dass Verwechslungen vorkamen. Mit den ungeduldigen Herren ergaben sich schwierige Situationen, und eine Art Garderobenmarke musste eingeführt werden. Das Baldreit-Stipendium von Baden-Baden war für einen 'artist in residence' ausgelegt: d.h. man erwartete, dass der Aufenthalt des Stipendiaten/der Stipendiatin (der/die ein Komponist, ein bildender Künstler oder ein Autor sein konnte) innerhalb von 12 Monaten irgendeine Wirkung für die Stadt zeigte. In dieser Zeit hatte man eine kleine Dachwohnung unterhalb des Schlosses ('Im Baldreit') zur Verfügung.
Das Baldreit-Stipendium von Baden-Baden war für einen 'artist in residence' ausgelegt: d.h. man erwartete, dass der Aufenthalt des Stipendiaten/der Stipendiatin (der/die ein Komponist, ein bildender Künstler oder ein Autor sein konnte) innerhalb von 12 Monaten irgendeine Wirkung für die Stadt zeigte. In dieser Zeit hatte man eine kleine Dachwohnung unterhalb des Schlosses ('Im Baldreit') zur Verfügung. schwebte ein literarisches Netzwerk vor.
schwebte ein literarisches Netzwerk vor.  Aber ich wurde auch von wildfremden Leuten angesprochen: etwa wenn ich mit dem Kinderwagen in der Fußgängerzone unterwegs war und man zeigte sich glücklich, dass ich den Geist (und den Nerv) der Stadt getroffen hatte.
Aber ich wurde auch von wildfremden Leuten angesprochen: etwa wenn ich mit dem Kinderwagen in der Fußgängerzone unterwegs war und man zeigte sich glücklich, dass ich den Geist (und den Nerv) der Stadt getroffen hatte.







































